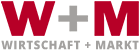W+M sprach mit dem Sächsischen Staatsminister für Wirtschaft und Arbeit Martin Dulig über die Herausforderungen an die sächsische Wirtschaft, den Zusammenhalt der ostdeutschen Länder und was alles 2023 passieren sollte.
W+M: Herr Minister, Sie sind jetzt seit acht Jahren Wirtschaftsminister. Wie haben Sie diese Jahre aus heutiger Sicht empfunden?
Martin Dulig: Es ist tatsächlich so, dass ich der dienstälteste SPD-Wirtschaftsminister bin und ich habe in dieser langen, aber trotzdem auch kurzen Zeit sehr viele Dinge erlebt. Die Lebensweisheit, dass nichts wirklich planbar ist, hat sich für mich jedenfalls bestätigt.
Es sind die Hindernisse und Umwege, die einen letztlich weiterbringen. 2014 bin ich Minister geworden, 2015 hatten wir die Flüchtlingskrise, es folgte die Braunkohleausstiegsdiskussion, wir hatten Corona, das Thema Fachkräftemangel. Der Ukrainekrieg gab dem Ganzen noch eine neue Dimension. Deshalb reden wir ja von einer Zeitenwende.
Wir leben in einer Phase der Transformation. Und wenn wir diese Phase betrachten, haben wir doch vieles richtig gemacht. Eine Insolvenzwelle ist nicht gekommen, viele Unternehmen haben trotz lautem Klagen Gewinne machen können. Eine prophezeite Massenarbeitslosigkeit blieb ebenfalls aus. Das zeigt, dass die Wirtschaftsverbände zwar gern schnell klagen, aber die Substanz und die Resilienz der Wirtschaft doch viel robuster sind. Daher rührt auch meine grundsätzliche Zuversicht für die Zukunft. Bisher haben wir alle Krisen bewältigt.
W+M: Wie hat sich die Wirtschaft Sachsens im Jahr 2022 entwickelt? Wie stark waren die Beeinträchtigungen angesichts der Krisen?
Martin Dulig: Sachsen Wirtschaft ist kleinteilig. 90 Prozent der Unternehmen sind klein- und mittelständisch und haben weniger als zehn Beschäftigte. Das ist Fluch und Segen zugleich. Es ist segensreich, wenn es um die notwendige Flexibilität geht, auf Veränderungen schnell zu reagieren. Es hat aber auch den Nachteil, dass bei Unternehmen, deren Eigenkapitaldecke geringer ist, selten eigene Forschung betrieben wird und damit die Innovationskraft eingeschränkt ist. Diese Differenziertheit ist aber typisch ostdeutsch.
Des Weiteren ist Sachsen ein Industrieland. Damit sind wir, genauso wie andere Industrieländer, von den gestörten Lieferketten und der Ressourcenproblematik betroffen. Aber auch hier hat sich die sächsische Wirtschaft behauptet. Die Unterstützung der Bundesregierung mit den Energiepreisbremsen war enorm wichtig, weil die Wirtschaft am dringendsten Verlässlichkeit benötigt. Natürlich sind die Energiepreise gestiegen, aber sie sind jetzt gedeckt und planbarer geworden. Das hat massiv auch zur Beruhigung beigetragen, wenn ich an den vergangenen Sommer denke, wo zurecht Maßnahmen vom Bund angemahnt wurden, weil die bisherigen Instrumente oder bloße Marktregulierung nicht mehr griffen.
Fazit: Wir sind glimpflich durch die Krise gekommen.
W+M: Dabei war Sachsen das einzige Land, das bei den Coronahilfen keine Zuschüsse gewährte. Warum das?
Martin Dulig: Bei den Coronahilfen gab es Bundesprogramme mit Zuschüssen, die auch Unternehmen in Sachsen nutzten. Diese Bundesprogramme haben aber nicht alle Unternehmen erreicht. Gerade für die kleinen Unternehmen brauchte es zusätzlich Länderprogramme. Hier hat Sachsen als einziges Bundesland nicht auf Zuschüsse gesetzt, weil wir uns die Frage gestellt haben, was wirklich benötigt wird. Gebraucht wurde vor allem Liquidität und so haben wir anstelle eines geringen Zuschusses günstige Darlehen in Höhe eines Viermonatebedarfs angeboten und mit speziellen Rückzahlungsboni versehen. Damit wurde ein größerer Betrag bereitgestellt, als er durch Zuschüsse möglich gewesen wäre – und das hat letztlich wohl auch mehr geholfen. Das spiegeln uns jetzt auch die Unternehmen so.

W+M: Wie hat sich die Wirtschaft auf die Zukunft eingestellt? Gibt es Leuchttürme, die eine Hervorhebung für ihr Agieren in der Krise verdienen?
Martin Dulig: Ich würde diese Frage nicht auf die Krisenbewältigung reduzieren. Wir haben neben der Coronakrise und den Herausforderungen im Zusammenhang mit dem russischen Krieg in der Ukraine viele Probleme, die wir vorher schon hatten, weiterhin auf der Tagesordnung. Wir beschreiben das mit dem Begriff der Transformation. Vor ein paar Jahren ging es noch separat um die Klimaziele, die Dekarbonisierung der Wirtschaft usw. Der Begriff der Transformation hat sich als Synonym für den gesamten Wandel bewährt.
Deshalb möchte ich Leuchttürme nennen, die trotz und wegen der Krisen sich erfolgreich der Transformation gestellt haben. Hervorheben will ich hier Volkswagen. VW hat ja schon vor der Krise die Entscheidung getroffen, dass die gesamte Elektromobilitätspalette des Konzerns in Zwickau umgesetzt wird. Das hat die Beschäftigten einerseits gefreut, aber vor allem die älteren verunsichert, weil sie sich nicht mehr auf eine Schulbank setzen lassen wollten. Volkswagen hat es geschafft, sämtliche Beschäftigte mit einem großartigen Konzept für die neuen Aufgaben zu motivieren. Das erfolgte über den Aufbau eines Weiterbildungszentrums, das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Erfolg schulte. Volkswagen hat damit ein Beispiel geschaffen, wie Transformation funktioniert. Es geht darum, die Menschen mitzunehmen, denn viele sehen keine Notwendigkeit für Veränderungen bzw. haben Angst davor.
Ein zweites Beispiel für Sachsen ist die Mikroelektronik. Inzwischen haben ja alle verstanden, dass allein durch die Digitalisierung und die Notwendigkeit, weniger von asiatischen und amerikanischen Märkten abhängig zu sein, die Chipproduktion in Europa hochgefahren werden muss. Die nötigen Kapazitäten entsprechen dem 20-fachen des aktuell Verfügbaren. Da haben wir in Sachsen natürlich eine riesengroße Chance, weil wir hier bereits der führende Standort in Europa sind. Es ist auch kein Widerspruch, wenn Intel jetzt nach Sachsen-Anhalt geht. Es ist wichtig für den Vorsprung Ost, weil wir zeigen, dass wir hier im Osten die Voraussetzungen haben, um Spitzenpositionen einzunehmen. Wir erweitern damit auch den Arbeitsmarkt. Die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind die Fachkräfte und die Investitionen in die erforderliche Infrastruktur. Und das macht diese Branche mit den Entscheidungen von Bosch, sein Werk auszubauen, und von Infineon, über fünf Milliarden Euro in eine neue Chipproduktion in Sachsen zu investieren, zu einem Leuchtturm in Europa.
Diese Leuchttürme werden gebraucht, um die Zukunft erfolgreich zu gestalten.
W+M: Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland sinkt angesichts der hohen Energiekosten. Ist Ihr Land noch bei in- und ausländischen Investoren gefragt?
Martin Dulig: Ohne etwas beschönigen zu wollen, kann ich sagen, dass wir zwar sehr gute Voraussetzungen haben, aber wir konkurrieren nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern mit allen Wirtschaftsregionen weltweit, egal ob um Innovationen oder um die besten Köpfe.
Das Thema Energie ist im weltweiten Wettbewerb eine Herausforderung und Sachsen ist Schlusslicht beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben sehr viele Ansiedlungsanfragen, ungeachtet der Krisen. Aber es gibt nicht eine einzige Ansiedlungsanfrage, die nicht sichergestellt haben will, dass 100 Prozent erneuerbare Energien angeboten werden. Und hier sind wir im Nachteil. Das Thema wurde von einigen Parteien zu lange als Kulturkampf betrachtet – ohne dabei an die Sicherung der Arbeitsplätze zu denken. Wir haben auch nach wie vor strukturelle Nachteile beim Thema Energie durch höhere Netzentgeltzahlungen, was eine Ungerechtigkeit darstellt und zu einem Standortnachteil führt.
Es gibt aber auch Standortvorteile, weshalb ich gern vom Vorsprung Ost spreche. Fast jedes Land hat zwar mittlerweile Wasserstoff-Konzepte und -Strategien. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben wir aber deutlich bessere Voraussetzungen beim Thema grüner Wasserstoff als anderswo, weil wir hier entlang der gesamten Wertschöpfungskette über das nötige Know-how verfügen. Wir haben etwa in Sachsen nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern auch die Unternehmen, die Elektrolyseure bauen, etwa Sunfire, Linde oder Siemens Energy. Wir haben Flächen in der Lausitz, die nach der Braunkohle für die Erzeugung erneuerbarer Energien bereitstehen und wir haben die Anwendungen für die Industrie, speziell im Bereich der Mobilität. Das heißt, wir haben in Ostdeutschland riesengroße Chancen, unsere Wettbewerbsstärke weiter auszubauen und tatsächlich vor den westdeutschen Bundesländern zu liegen.
Ich bin übrigens positiv überrascht, wenn ich auf meine achtjährige Amtszeit zurückschaue, wie sich alles entwickelt hat. Am Anfang war der Eindruck, dass sich die Ansiedlungspolitik großer Unternehmen dem Ende neigt, dass es mehr um endogenes Wachstum geht. Dann erlebten wir eine Renaissance der Ansiedlungen, vor allem in zukunftsfähigen Branchen, beispielsweise bei der Batteriezellenproduktion, bei der Chipindustrie und der Erzeugung erneuerbarer Energie mit Windkraft und Solar. Leider haben wir in Europa zugelassen, dass die Solarwirtschaft speziell in Deutschland kaputtgegangen ist. Mit Meyer Burger haben wir jetzt erstmals wieder ein Unternehmen, was Solarmodule selbst produziert. Auch das ist ein Leuchtturmprojekt.
Ostdeutschland und Sachsen sind attraktiv für Neuansiedlungen, es ist aber kein Geschenk, für das man nichts tun muss.
Der Staat muss die Rahmenbedingungen für gutes Arbeiten, für Zuwanderung schaffen und Bindekräfte entwickeln, damit die Leute auch bleiben. Dazu gehören auch massive Investitionen in die Infrastruktur. Dabei haben wir aktuell kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Geschwindigkeitsproblem.
W+M: Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit den übrigen ostdeutschen Nachbarländern? Gibt es hier konkrete Projekte?
Martin Dulig: Es ist jetzt keine Höflichkeitsfloskel, aber diese Zusammenarbeit ist Teil des Erfolges, diese Wirtschaftsregion zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur entwickelt zu haben.
Wenn die Energieländer Sachsen, Sachsen–Anhalt und Brandenburg nicht gemeinsam agiert hätten, wären wir niemals so erfolgreich beim Kohlekompromiss gewesen. Die Lausitz endet nicht an irgendeiner Landesgrenze, genauso wie es der Industrieregion Mitteldeutschland egal ist, wo eine Landesgrenze verläuft. Eine Wasserstoffpipeline aus Bitterfeld, die Unternehmen um Leipzig herum versorgt, kann nicht an der Landesgrenze aufhören.
Es ist sicher auch ein großer Vorteil, dass wir uns als Wirtschaftsminister untereinander gut verstehen. Ich habe mich für meinen Freund Jörg Steinbach aus Brandenburg gefreut, als Tesla sich dort angesiedelt hat, ebenso wie für meinen Kollegen Sven Schulze in Sachsen-Anhalt über die Ansiedlung von Intel bei Magdeburg. Mit Wolfgang Tiefensee stimme ich mich regelmäßig ab, weil viele Mikroelektronikstandorte zwischen Thüringen und Sachsen liegen. Auch wenn Mecklenburg-Vorpommern kein Nachbarland ist, ist die Zusammenarbeit gerade jetzt wichtig, wenn es um das Thema Gas geht und das LNG-Terminal in Lubmin. Uns alle treibt eine Sorge um: Kommt das Gas nicht mehr aus dem Osten, sondern aus dem Westen, könnte dies von Nachteil für uns sein.
Zusammengefasst: Es ist eine Stärke, dass wir nicht kleinstaatlich, sondern überregional denken und agieren, ohne dabei die Länderinteressen zu vernachlässigen.
So gesehen, helfen alle Ansiedlungen in Ostdeutschland den ostdeutschen Bundesländern insgesamt. Ich vertrete konsequent den Kurs des Vorsprungs Ost, denn wir müssen auch den Menschen die Zuversicht geben, dass sie in dem bestehenden Wandlungsprozess zu den Gewinnern gehören können. Mit dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum wurde da auch eine gute Grundlage geschaffen, denn Plakate und Slogans genügen nicht.

W+M: Auch wenn die Erreichung der Klimaziele aktuell durch verschiedene Krisen erschwert wird, sind sie doch gesetzt. Wie kommt Sachsen bei der Schaffung erneuerbarer Energien voran?
Martin Dulig: Aktuell ärgere ich mich über das Scheingefecht zum Kohleausstiegsjahr, denn es ist ausschließlich ideologiegetrieben. Für uns als Industrieland steht im Mittelpunkt, dass wir auch weiterhin unsere Energie produzieren können. Einfach zu sagen, es ist egal, woher die Energie kommt und notfalls importieren wir sie, halte ich für verantwortungslos.
Die eigentliche Frage muss doch lauten: Wie sieht unser Energiemix 2030, 2035 und 2038 aus? Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Die Antwort muss die Bundesregierung bzw. das BMWK geben. Der Ausstieg 2038 wurde unter Voraussetzungen getroffen, dass Gaskraftwerke für den Übergang gebaut werden sollten – das Thema ist vom Tisch. Die Frage ist also, welche Voraussetzungen sind zu erfüllen, dass eine Versorgung mit 100 Prozent erneuerbarer Energie möglich wird. Erst den Zeitpunkt zu bestimmen und dann über das Wie nachzudenken – das ist falsch.
Was tun wir in Sachsen konkret? Wir haben ein neues Energie- und Klimaprogramm aufgelegt, was ein hartes Stück Arbeit war bei einer Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Und mit dem neuen Bundesgesetz im Rücken haben wir jetzt auch die Verpflichtung, zwei Prozent unserer Fläche für erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen. Ein ganz wichtiger Schritt dabei war, auch Flächen zu nutzen, die wir bislang nicht im Blick hatten. Das sind nicht nur Kohlenachfolgelandschaften, sondern auch beachtliche Flächen an Nutzwald, die eben keine Landschaftsschutzgebiete sind. Diese Wind-über-Wald-Flächen werden wir jetzt zur Nutzung freigeben und gleichzeitig die Genehmigungsverfahren beschleunigen, denn es kann nicht sein, dass man für die Genehmigung eines Windparks sechs Jahre benötigt. Das betrifft jetzt nicht nur Sachsen, aber wir haben hier besonderen Nachholbedarf.
W+M: Der Ausbau der erneuerbaren Energien braucht mehr Tempo. Darin sind sich alle einig. Im Jahr 2022 war von mehr Tempo wenig zu spüren, wie sieht es mit der Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungszeiten in Ihrem Bundesland aus?
Martin Dulig: Widerspruch! Die Bundesregierung hat sich gerade selber einen neuen Maßstab gegeben. Wer es schafft, in sieben Monaten LNG-Terminals zu bauen, setzt neue Maßstäbe. Dafür hätte man sonst Jahre gebraucht.
Massive Investitionen in die Infrastruktur sind erforderlich. Dazu benötigen wir auch viel privates Kapital, aber der Staat ist in der Verantwortung, für Schnelligkeit zu sorgen. Zwischen Genehmigung und Bau müssen die Zeiten mindestens halbiert werden. Wir müssen klären, welche Gerichtsinstanzen notwendig sind, inwieweit wir mit Genehmigungsfiktionen arbeiten können. Das bedeutet: Wenn innerhalb einer Frist keine Genehmigung erteilt werden kann, gilt sie als erteilt. Auch komplizierte Kosten-Nutzen-Rechnungen sind infrage zu stellen, wenn der politische und wirtschaftliche Wille klar ist. So kommen wir voran. In der Vergangenheit haben viele Anstrengungen zum Bürokratieabbau oftmals zu einer weiteren Verkomplizierung beigetragen. Das kann sich jetzt keiner mehr leisten und deshalb sind diese Zeiten vorbei. Dass der Digitalisierung dabei eine gewichtige Rolle zukommt, erklärt sich hier von selbst.
W+M: Glauben Sie im Ernst, dass das Beispiel des Baus der LNG-Terminals als Blaupause für alle künftigen Infrastrukturinvestitionen gelten kann?
Martin Dulig: Ich sehe keine Alternative, wenn wir im internationalen Wettbewerb bestehen wollen. Und Europa ist ja nicht im besten Zustand, wenn ich mir die dynamischen Mitbewerber in der Welt anschaue. Will Deutschland weiter der wirtschaftliche und innovative Motor in Europa sein, dürfen Infrastrukturprojekte keine Aufgaben für Generationen mehr sein.
W+M: Was muss 2023 unbedingt gelingen?
Martin Dulig: Die Grundvoraussetzung ist Frieden auf der Welt. Denn ohne Frieden ist alles nichts. 2023 muss es uns gelingen, unsere Energieversorgung sicherzustellen. 2023 müssen wir es schaffen, den Hebel bei den Infrastrukturmaßnahmen umzulegen.
2023 sollten wir unsere Arbeits- und Fachkräfteprobleme endlich so angehen, dass wir auch den erforderlichen kulturellen und strukturellen Wandel vollziehen. Dafür müssen wir unser Land so aufstellen, dass wir für Zuwanderung attraktiv sind. Dabei zählt immer ein Faktor besonders: Es kommen keine Arbeits- und Fachkräfte nach Sachsen, es kommen Menschen! Menschen mit Familien, Bedürfnissen und Träumen. Es kommen neue Sachsen – die wir willkommen heißen und nicht skeptisch irgendwo isolieren können.
Und damit schließt sich der Kreis, wenn ich mir für 2023 nicht nur den äußeren, sondern auch mehr inneren Frieden wünsche. Dass wir den Zusammenhalt wieder stärker in den Mittelpunkt stellen, um die entstandene Spaltung der Gesellschaft aufzuheben.
Interview: Frank Nehring